Blicken Sie in einen Spiegel, sehen Sie sich. Doch das Spiegelbild trügt. Vor Ihnen steht eine innige Gemeinschaft von Mensch und Kleinstlebewesen. Denn unser Spiegelbild zeigt nur zu 43 Prozent Zellen, die menschliches Erbgut enthalten. 57 Prozent oder 39 Billionen Zellen stammen von winzigen Mitbewohnern, den Mikroben. Das sind vor allem Bakterien.

„Ohne sie kann kein Mensch leben“, betonte Professor Ansgar Lohse in seinem Vortrag auf der Gesundheitsakademie UKE. „Manche lebensnotwenigen Stoffe wie beispielsweise Vitamin K, ohne das wir verbluten würden, erhalten wir nur dank der Arbeit der Kleinstlebewesen in unserem Darm. Mit bis zu einer Billion Lebewesen je Gramm Darminhalt ist der Dickdarm der am dichtesten besiedelte Ort der Welt“, ergänzte der Gastroenterologe, der Direktor der 1. Medizinischen Klinik des UKE ist.
Die Vorstellung, dass nur menschliche Zellen unser Leben regeln, hat Biologie und Medizin lange geprägt. Doch sie ist ein Mythos. Das enthüllen neuere Ergebnisse der Forschung. Sie zeigen, wie gewaltig das Mikrobiom, also die Gesamtheit aller Winzlinge, auf und in unserem Körper einwirkt. Sie machen uns offenbar zu dem, was wir werden, was wir sind. Das Mikrobion beeinflusst unsere Gesundheit, unser Gewicht und vielleicht sogar unsere Stimmung und unser Verhalten.
Gleichwohl haben die Mikroben ein Imageproblem, weil unter ihnen auch fiese Keime wandeln, die uns erkranken lassen. Sie gewinnen die Oberhand, wenn das gut austarierte Gleichgewicht gestört ist. Antibiotika zählen zu den Medikamenten, die das Gleichgewicht verschieben können. Denn sie treffen nicht nur die krankmachenden Bakterien, sondern ziehen leider auch die förderlichen Kleinstlebewesen in Mitleidenschaft. Auch deshalb sollten Antibiotika nur verabreicht werden, wenn es nötig ist. In der Regel leben wir friedlich mit unserem Mikrobiom zusammen.
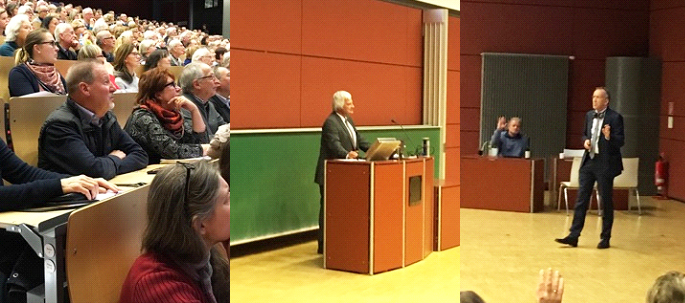
Es gibt aber noch ein überraschendes Forschungsergebnis: Die Bakterien gleicher Körperregionen, also der Haut, des Mundes, der Vagina oder des Darmes sind von einem Menschen zum anderen teilweise grundverschieden. Das Erbgut aller Menschen stimmt zu 99,99 Prozent überein. Doch ihre Darmflora ist manchmal nur zu zehn Prozent identisch, zeigen Forschungsergebnisse aus den USA. Und das macht einen großen Unterschied. So klettert der Blutzuckerspiegel bei manchen Menschen sehr schnell hoch, wenn sie Bananen essen – aber nicht, wenn sie süße Plätzchen essen, was zu erwarten wäre. „Es gibt also individuelle Unterschiede und daher können allgemeine Vorschläge zur gesunden Ernährung auch nicht auf alle Menschen zutreffen“, betonte Prof. Lohse. Die Zukunftsvision sei, diese Unterschiede analysieren zu können, um individuell angepasste Ernährungsratschläge zu geben. „So könnten wir vielleicht verhindern, dass sich eine Zuckerkrankheit oder Übergewicht entwickelt.“
Versuche mit Mäusen zeigen, dass die Tiere, die ein Mikrobiom von dicken Mäusen bekamen, auch dick würden. Doch kann das nicht einfach auf den Menschen übertragen werden. Eines allerdings sei jetzt schon klar. „Es ist nicht so wichtig, was Sie essen. Entscheidend für ein gesundes Gewicht ist, wie viel Sie essen!“
In 20 Jahren, so prophezeit der Mediziner, wird das Zusammenspiel der Milliarden von Bakterien vermutlich so weit verstanden sein, dass das Mikrobiom gezielt behandelt und eine individuelle Ernährungsmedizin möglich ist.
Bis dahin gilt: Wer nicht zu viel isst, stark verarbeitete Produkte meidet, sich vielfältig ernährt, viel Gemüse, Getreide oder Hülsenfrüchte verzehrt, auf Zuckerersatzstoffe verzichtet, Milch und Milchprodukte genießt, ausreichend schläft und sich regelmäßig bewegt, tut viel für seine Gesundheit – und die unserer Mitbewohner. (ang)